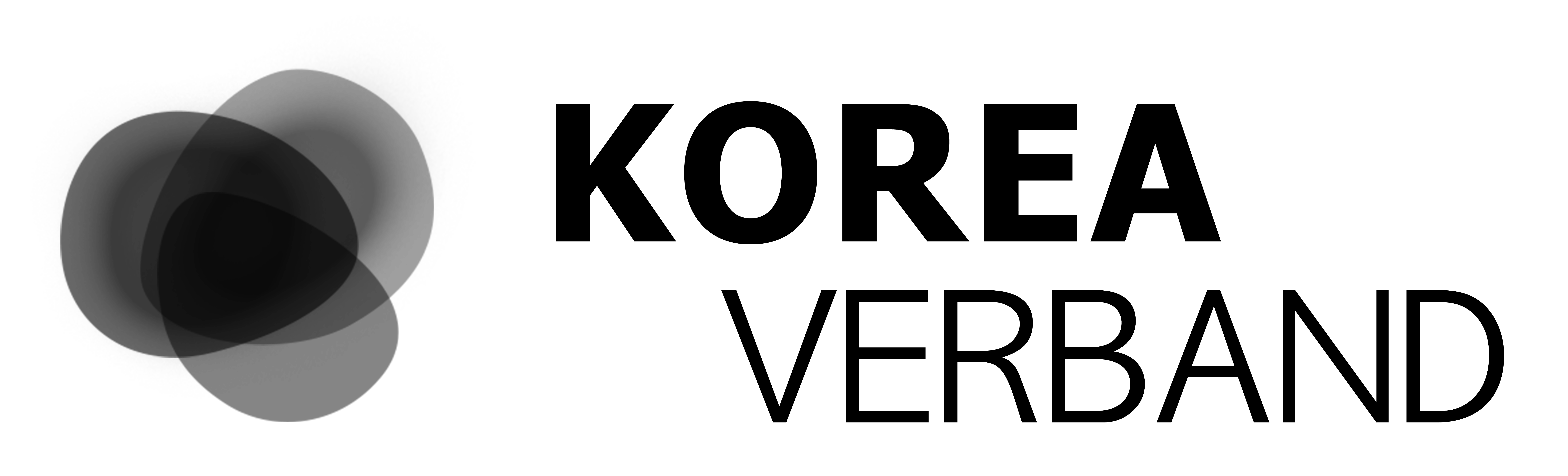Gedenken an Phan Văn Toàn
Gedenkinitiative Phan Văn Toàn Am 31. Januar 1997 wurde Phan Văn Toàn Opfer einer rassistischen Gewalttat am S‑Bahnhof Fredersdorf. Drei Monate später starb er an den direkten Folgen dieses Angriffs. Die Gedenkinitiative Phan Văn Toàn setzt sich seit 2020 für ein würdiges Gedenken an Phan Văn Toàn und für eine politische Einordnung der rassistischen Tötung in damalige und aktuelle Verhältnisse ein. Eine der ersten Intentionen der Gedenkinitiative war es, Phan Văn Toàn in Fredersdorf, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Berlin, und darüber hinaus nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die erste Gedenkkundgebung fand am 31. Januar 2021 in Fredersdorf statt. Sie wurde organisiert von der VVN-BdA Märkisch-Oderland und der BOrG. Die VVN-BdA ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschist*innen und die BOrG ist die Abkürzung für Beratungsgruppe für Opfer rechter Gewalt, eine ehrenamtliche Beratungsgruppe in Märkisch-Oderland. Die BOrG recherchierte 2020 zu Todesopfern rechter Gewalt im Landkreis. Dabei fiel ihnen auf, dass es kein öffentliches Gedenken an Phan Văn Toàn gab. Nach dieser ersten Gedenkkundgebung gründete sich unsere Gedenkinitiative, um ausführlicher und auch communitybezogener an Phan Văn Toàn zu erinnern. Zuerst bestand die Initiative aus lokalen Aktivist*innen. Wenig später wurde korientation, eine post-migrantische Selbstorganisation und Netzwerk